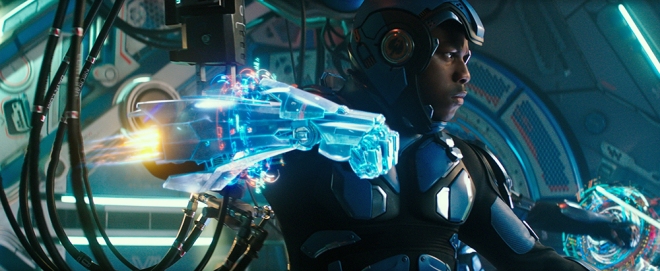MAKE AMERICA BREAK AGAIN
8,5/10
 © 2024 A24 / DCM
© 2024 A24 / DCM
LAND / JAHR: VEREINIGTES KÖNIGREICH, USA 2024
REGIE / DREHBUCH: ALEX GARLAND
CAST: KIRSTEN DUNST, WAGNER MOURA, CAILEE SPAENY, STEPHEN MCKINLEY HENDERSON, JESSE PLEMONS, NICK OFFERMAN, SONOYA MIZUNO, JEFFERSON WHITE, NELSON LEE U. A.
LÄNGE: 1 STD 49 MIN
Der Sturm aufs Kapitol hätte der Anfang werden können für etwas, dass wohl die ganze Weltordnung neu geschrieben hätte. Denn wir wissen längst: Die Vereinigten Staaten von Amerika haben diese immer schon mitbestimmt, war es nun der Erste oder der Zweite Weltkrieg, Operation Wüstensturm, der Sturz Saddam Husseins oder die Bereitschaft, die Ukraine gegen den russischen Aggressor mit allerhand Kriegsmaterial zu unterstützen. Das US-Amerika ist nicht nur Entscheidungskraft im weltpolitischen Handel, auch die Lebenswelt in Übersee ist uns dank des übereifrigen Outputs an Hollywood-Filmen so dermaßen vertraut, als würde man selbst dort drüben leben. Keine andere Staatengemeinschaft wie diese hat dermaßen viel Einfluss. Umso erschreckender muss es also sein, wenn die selbsternannte Weltpolizei, die geschlossen gegen die Achsen des Bösen angekämpft hat, plötzlich und im eigenen Land nicht mehr Herr der Lage ist und von innen heraus zerbricht. Es wäre eine Katastrophe langen Atems und alles umstürzend, was die Wohlstandswelt wertschätzt.
Als Anfang von etwas Neuem und zweifelhaft Gutem hätte der 6. Januar 2021 zwar nicht sogleich einen Krieg, dafür aber einen weitaus größeren Erdrutsch verursachen können, der Folgen nach sich ziehen hätte können, die Alex Garland nun in die existenzgefährdenden Albträume der US-amerikanischen Bevölkerung als böse Saat einpflanzt. Der Umbruch ist in Civil War längst nicht mehr aufhaltbar, die Ordnung ist dahin, der Notstand ein Euphemismus. Dieser Film ist nichts, was uns Europäer nicht angeht. Er bedient die größte Angst der westlichen Welt, ihre prachtvolle Convenience-Blase platzen zu sehen. Weil plötzlich ist, was nicht sein darf. Weil die Welt nur immer woanders zugrunde geht, nur nicht hier, wo der Überfluss alles richtet.
Civil War ist weniger ein politischer Film. Alex Garland ist es sowas von egal, wer nun wen bekämpft, welche politischen Agenden dahinterstecken, welche Ideale nun kolportiert werden und was sich der noch amtierende Präsident der Vereinigten Staaten eigentlich hat zuschulden kommen lassen, um jetzt um sein Leben zu bangen. Denn schließlich ist es ja so, dass jene Recht behalten, die dieses Gemetzel gewinnen. Kriege verlieren hingegen sehr schnell ihren Sinn, der Ausnahmezustand schafft ein Vakuum, in dem sich nur schwer ein gewisser Alltag leben lässt. Und wenn doch, erscheint er grotesker als alles andere. So einen Zustand müssen die vier Journalistinnen und Journalisten Lee, Jessie, Joel und Sammy erstmal verdauen und als gegeben akzeptieren. Sie sind unterwegs quer durchs Land, um zur rechten Zeit am richtigen Ort den schwindenden Präsidenten zu einigen letzten Worten zu bewegen, denn alles sieht danach aus, als stünden die Western Forces kurz davor, auch die letzte Bastion der alten Paradigmen niederzureissen. Es ist wie die Schlacht um Berlin, die Schlacht um Bagdad, die Schlacht um eine heile falsche Welt, die bald entbrennen wird. Das Quartett möchte vor allen anderen ins Weiße Haus gelangen, der Ehrgeiz des Reporters ruft, und die Versuchung, zu selbigem des Satans zu werden, lockt wie schnöder Mammon. Sie versuchen, Würde zu wahren und so zu tun, als würde sie der jeweils andere interessieren. Eine Zweckgemeinschaft, die während einer über 800 km langen Fahrt Zeuge einer Zombieapokalypse nur ohne Zombies wird, in der rechtsextreme Republikaner die Gelegenheit am Schopf packen, ihre Welt von allem Fremden zu säubern, Scharfschützen ohne Fraktion einander die Birne wegschießen und Lynchjustiz an der Tagesordnung steht. Es sind Bilder, die man von woanders kennt.
Endlich sieht man mal wieder Kirsten Dunst in einer Rolle, die ihr auf den Leib geschneidert scheint. In längst abgestumpfter Professionalität einer Kriegsreporterin hat sie alles schon gesehen, nur sie selbst war noch nie wirklich Teil davon. Wagner Moura als jovialer Cowboy, Stephen Henderson als der amerikanische Christian Wehrschütz, der schon längst in den Ruhestand hätte treten sollen, es aber nicht lassen kann, und zuletzt Cailee Spaeny (Priscilla) als kindlicher Ehrgeizling, der zum einen eine Scheißangst vor dem Krieg hat, zum anderen aber bald die Gefahr als Droge missbraucht, um noch bessere Bilder zu machen als Lee Smith aka Kirsten Dunst, die es anfangs für keine Gute Idee hält, dieses Greenhorn mitzunehmen. Garland schafft mit diesen „Vieren im Jeep“ neben all der Kriegsstimmung und des Notstands ein Ensemblespiel in kunstvoller Effizienz, was das Portraitieren von Charakteren angeht. Civil War ist Kriegsreporter-Kino allererster Güte, so eindringlich wie Salvador oder The Killing Fields – und dann das: Anders als all die besten aus der Hochzeit des Politkinos Ende der Achtziger fühlt sich Civil War aufgrund seiner Nähe zu einer uns wohlbekannten Welt und einem unmittelbarem Zeitgeist tatsächlich so an, als sähe man das, worüber Garland berichtet, in den hauseigenen Nachrichten. Civil War ist das schweißtreibende Imitat einer nahen, möglichen Realität, die scheinbar Unzerstörbares aushebelt und niederringt. Immer wieder findet Garland Bilder von weltvergessener Schönheit und konterkariert seinen Krieg mit einer Compilation aus Countrysongs, Hip Hop- und Space Rock, die das Gesehene so irreal erscheinen lassen wie Napalmbomben am Morgen unter den Klängen von The Doors. Coppolas Antikriegs-Meisterwerk Apocalypse Now wirft Garland auch verstohlene Blicke zu – so manche Szene ist zu bizarr, um ihm Glauben zu schenken. Der Boden unter den Füßen findet kaum Halt.
Gegen Ende uns Zusehern vor die Füße geworfen, ist die Schlacht um Washington D.C ein Brocken selten gesehener, moderner Kriegsführung, sie gerät weder prätentiös noch pathetisch, sondern so authentisch wie der Lockdown oder Flüchtlingsströme vor der Haustür. Auf diesen Zug, in welchem Good News Bad News sind und Bad News irgendwann vielleicht Good News werden, springt Civil War auf und fährt die Achterschleife. Garland bringt seinen Plot dramaturgisch auf den Punkt, lässt weg, was den Höllenritt nur ausbremst, lässt manches im Geiste seines Publikums weiterspinnen, redet auch nicht lang drum herum. Als klar wird, dass die Härte und Arroganz der Kriegsführung im eigenen Land auch jener entspricht, mit der die USA bereits allerorts auf dieser Welt einfielen, wird einem so richtig mulmig. Die Zivilisation zeigt sich als Camouflage, der Altruismus in Krisenzeiten als Lippenbekenntnis. Wo es die Menschheit hinbringt, lässt Garland im Ungewissen. Was sie anstachelt, ist weniger der Mut zur Veränderung als lediglich die Gier nach einem wie auch immer gearteten Sieg.