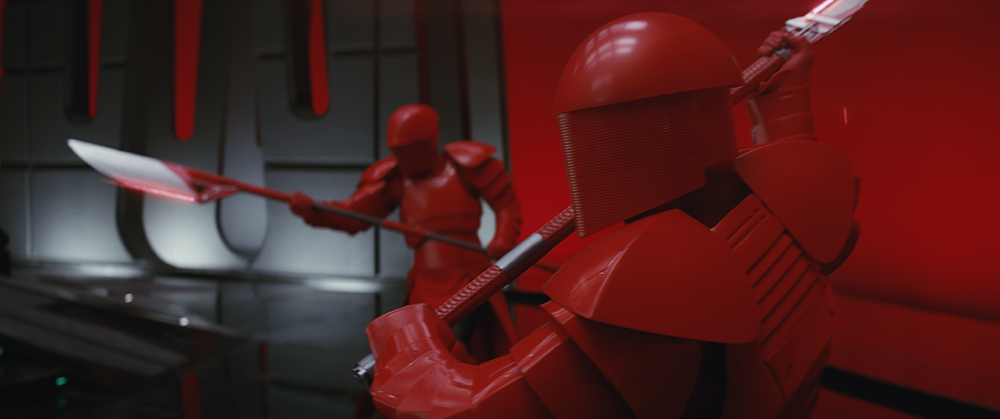DER DUDE DES UMBRUCHS
7/10
 © 2025 Warner Bros. Pictures
© 2025 Warner Bros. Pictures
LAND / JAHR: USA 2025
REGIE: PAUL THOMAS ANDERSON
DREHBUCH: PAUL THOMAS ANDERSON, NACH DEM ROMAN VON THOMAS PYNCHON
KAMERA: MICHAEL BAUMAN
CAST: LEONARDO DICAPRIO, SEAN PENN, CHASE INFINITI, TEYANA TAYLOR, REGINA HALL, BENICIO DEL TORO, WOOD HARRIS, ALANA HAIM, D. W. MOFFETT, TONY GOLDWYN, ERIC SCHWEIG U. A.
LÄNGE: 2 STD 42 MIN
Gerade noch auf der Couch, vernebelt bis dorthinaus, im Fernsehen läuft The Battle of Algiers, untermalt von den Takten eines Ennio Morricone, da läutet auch schon das Festnetz. Wie denn, was denn? Ein verfilzter Leo DiCaprio, der sich mal ordentlich gehen lassen darf, wird eiskalt abgeduscht, als sich Stimmen melden, die vor sechzehn Jahren zum letzten mal an sein Ohr drangen. Die Revoluzzer sind wieder da, und das niemals oder nur langsam älter werdende, unrasierte Babyface mit fettiger Mähne soll sich sputen! Natürlich kommt der Mann dann doch irgendwie in die Gänge, aber nur so, als wäre er hinter sich selbst her, ohne sich einzuholen. Doch wie heisst es so schön: Move your ass, your mind will follow.
Revolution ist geil
Nach diesem Leitsatz stolpert der Star also durch ein Chaos aus Staatsgewalt und den Morast der Verzweiflung ob vergessener Passwörter. Wir kennen das – wir scheitern, wenn wir uns bei unserem Lieblingsstreamer einloggen wollen, wenn der mal ein Update hatte. Es ist zum Haareraufen und Speichelspucken, zum Zetern und Schimpfen – all das, was DiCaprio gut kann und gerne tun will. Auf diese Weise wird uns allen aber klar: Auch wir könnten, wenn die Kacke so sehr am Dampfen ist, unseren inneren Schweinehund, der da als Couchpotato Wurzeln schlägt, ins Gesicht schlagen, uns aufraffen und den Widerstand besingen – gegen die weiße Herrenrasse, gegen den Faschismus, gegen die Indoktrinierung von rechtem Gedankengut. Denn: Revolution ist geil. Saugeil sogar. Paul Thomas Anderson findet das genauso cool. Zumindest so sehr wie den Autor Thomas Pynchon, aus dessen Schaffen er nun den zweiten, seiner Meinung nach einzig verfilmbaren Roman auf die Leinwand stemmt – allerdings nicht nur aus dem Grund, um nächstes Jahr bei den Filmpreisen groß abzuräumen. Sondern, weil sich Pynchon anscheinend maßlos gut dafür eignet, seinen individuellen Filmstil zu tragen, über hügelige Straßen, an militanten Nonnen vorbei, durch muffige Fluchtwege unter der Erde bis hin zu Sean Penns völlig entgleister Visage, dessen Mimik fast schon einen Film im Film darstellt.
Linksradikale Ballerfrauen
Diese Idee von der geilen Revolution, die muss Anderson ausschlachten. Die Agenden sind wohl zweitrangig, obwohl uns klar wird: Ja, es geht um Migration, ob illegal oder nicht, um Ausweisung, um Abschiebung, um die Brandmarkung aller nicht in den USA Geborenen als Drogenhändler, Katzenfresser und Streitsüchtige, die für Unreinheit in einer Reagan/Trumpwelt sorgen – schließlich sind die Ideen des Möchtegern-Alleinherrschers über die ganze Welt alle nicht neu, sondern halbwegs aufgetaut, um sie den Leuten zwischen Arsch und Couch zu schieben, als bequemes Kissen, weil die Sitzschwielen aufgrund der vielen Bequemlichkeit nicht mehr ausgesessen werden können. Doch anstatt sich den politischen Umständen, Umwälzungen und dem Kern der Sache hinzugeben, ist es wohl besser, die Ruppigkeit der Revolution als Ikonographien der gewaltbereiten Aufsässigkeit hinzustellen, ohne jemals darin die Chance ersichtlich machen zu können, dass all diese linksradikalen Ballerfrauen, ob hochschwanger oder im Tütü, mit ihrem Modus Operandi auch nur irgendetwas am System zu ändern.
Mehr als ein Thriller?
Revolution ist so ein Wort, das klingt nach Che Guevara und vielleicht auch Krieg der Sterne, nach rotzfrechen Heldinnen und Helden, die als schnöde Kriminelle die gute Sache nur noch kolportieren. Mit dieser Prämisse hat One Battle After Another so seine Probleme – als „Film der Stunde“, wie manche sagen, gibt Anderson seinem schauspielerischen Sprengkommando eine allzu lange Lunte in die Hand. Sie brennt und brennt, und währenddessen tut sich ein überraschend geradliniger und überhaupt nicht sonderlich komplexer Thriller auf, der in seinen besten Momenten die Absurdität von Breaking Bad atmet, orientierungslos grimassierend im Niemandsland des wüstenhaften Grenzgebiets – glutheisse Kulissen, die DiCaprio niemals dazu bewegen, seinen Bademantel abzulegen, denn der hat schließlich jetzt schon so sehr Kultstatus, dass sich das Outfit dieses Spätrevoluzzers bereits schon beim Faschingsprinzen bestellen lässt. Der Thriller aber ist handwerklich so sehr ausgereift, dass es allemal für denkwürdiges Kino reicht. Etwas gar penetrant mit Klavierklimpern unterlegt, sind nach einem grob gehobelten Epilog, der keine Chance dafür lässt, mit den Figuren warm zu werden, die Rechten und Linken positioniert. Erst jetzt sprudelt Anderson mit seinem Können nur so hervor, setzt groteske Sequenzen, Arthouse-Optik und Robert Altman-Stilistik, in Kubrick‘schem Weitwinkel und lakonischer Ironie.
Wenn am Ende die irre Suspense in einer schwindelerregenden Berg- und Talfahrt einer Autoverfolgungsjagd die niemals ihrem Schicksal entkommenden Gestalten aufeinandertreffen lässt, hat man das Gefühl, etwas Erfahrenswürdiges gesehen zu haben, etwas filmgeschichtlich Kultiges, und damit meine ich nicht zwingend Sean Penn, der hier als zum Femdschämen ideologisierter Tintifax DiCaprio die Show stiehlt. Wohl eher ist es die Erkenntnis, dass das Private, Intime, in dessen Dunstkreis sich jeder selbst der Nächste ist, weit mehr Priorität hat als der weltbewegende Umbruch, zu dem es nie kommt, weil immer wieder jemand anderer im Weg steht, dem das Hemd näher ist als der Rock.


 © 2023 Netflix
© 2023 Netflix