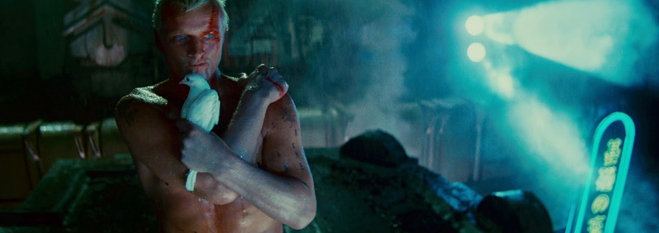DIE SIMULATION DER ZWEISAMKEIT
7/10
 © 2021 Majestic Filmverleih
© 2021 Majestic Filmverleih
LAND / JAHR: DEUTSCHLAND 2021
REGIE: MARIA SCHRADER
CAST: MAREN EGGERT, DAN STEVENS, SANDRA HÜLLER, HANS LÖW, WOLFGANG HÜBSCH, ANNIKA MEIER U. A.
LÄNGE: 1 STD 48 MIN
Es ist menschlich, sich was vorzumachen. Mit der eigenen zurechtverdrängte Realität lässt sich doch gut leben. Warum sollte man also da aufhören, wo es vielleicht am schönsten wäre? Bei der Partnerschaft. Manchmal reicht da einfach nur eine Stimme, um sich zu verlieben. Jean Cocteau hatte die Stimme am Telefon. Für Joaquin Phoenix in Spike Jonzes Her war Scarlett Johannsons Organ zu einer nicht körperlichen KI mehr als genug, um sich zu verlieben. Wenn dann aber ein attraktiver Mann mittleren Alters, augenscheinlich aus Fleisch und Blut, jeden Wunsch von den Augen abliest, kann das nur ein Erfolgsmodell werden. Damit nämlich rechnet eine in Berlin ansässige Robotik-Firma und hat bereits Eurozeichen in den Augen, als nur noch eine einzige Hürde überwunden werden muss, bevor die Innovation auf den Markt kommt: die Testung in privatem Haushalt. Für so etwas wird die Archäologin Alma mehr oder weniger zwangsverpflichtet. Sie muss den Partner-Androiden Tom für 3 Wochen mit zu sich nach Hause nehmen und auf die Frage Eignen sich Roboter als Partner-Ersatz? ein so gut es geht objektives Gutachten verfassen. Alma hat wenig Lust dazu, steckt sie doch bis über beide Ohren in einer Studienveröffentlichung zum Thema Keilschriften. Doch da muss sie durch – und nimmt den etwas hölzern wirkenden Charmebolzen mit in die eigenen vier Wände. Dieses Gekünstelte, so meint Tom, gibt sich bald – er muss seinen Algorithmus nur noch perfektionieren. Was aus diesen nächsten Wochen daraus entstehen mag – es ist nicht vorherzusehen. Und das ist schon mal eines der schönen Dinge, die diesen Film als etwas sehr Interessantes klassifizieren.
Ich bin dein Mensch ist ein Science-Fiction-Film, der noch weniger als Her visuellen Futurismus auch nur irgendwie nötig hat. Niemals blickt man in das Innere von Tom, niemals auch nur sind scheinbar schwebende Displays, Kabeln oder Knöpfe jemals relevant. Maria Schrader schlägt mit ihrem durchdachten Beitrag zum Informationszeitalter eine ganz andere Richtung ein. Dabei ist es, im Gegensatz zu ebenfalls recht durchdachten Filmen aus dem Roboter-Genre, auch nicht gerade die Frage der Ethik, die hier im Vordergrund steht. Für sie ist der Umstand, oder die Möglichkeit, alsbald einen Mensch-Ersatz menschlichem Willen zu unterwerfen, ein Umstand, der genauerer Betrachtung bedarf. Ein sozialpsychologisches Problem also. Eine ganz eigene Studie, die Maria Schrader hier betreibt, und für die sie mit Maren Eggert eine ebenso kritische wie leidenschaftliche Verfasserin gefunden hat. Vor ihr der charmante, ein bisschen als eine Mischung aus Anthony Perkins und James Stewart empfundene Gesellschafter – Dan Stevens (u. a. Die Schöne und das Biest, Downton Abbey) schafft als grüblerischer und gutmütiger Android mit britischem Akzent einen brillanten Balanceakt zwischen Star Trek´s Data und einem menschlichen Superhirn wie Sheldon Cooper, dazwischen aber gelingen ihm verblüffend menschliche Züge, bei welchen man als Zuseher fast schon selbst vergisst, dass dieser Tom eigentlich ein Roboter ist. Dabei zählen seine durchaus logisch nachvollziehbaren Handlungen, die enormes komödiantisches Potenzial entfalten, zu den wirklich witzigen Höhepunkten des Films.
Ich bin dein Mensch ist aber nur zum Teil Komödie. Im Grunde ist Schraders Film eine Gewissensfrage – an den Menschen im Zustand erdrückender Isolation und an ein künstliches Wesen, das vorgibt, alles zu verstehen. Die Simulation der Zweisamkeit allerdings kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, ist sie doch darauf ausgerichtet, die Grundmotivation der Lebenden, nämlich das Streben nach unerfüllten Wünschen, vorwegzunehmen. Doch andererseits… was weiß man.
Diese nachdenkliche, spitzzüngige und enorm pointierte Komödie über ein gesellschaftliches Grundproblem unserer Zeit schlägt zwar klar einen Kurs ein, lässt aber trotzdem alle Fragen offen. Und das in einer Zeit der vermeintlichen Fortschritte und anmaßenden Gewissheiten.