AUF TEUFEL KOMM RAUS
6/10
 © 2024 Twentieth Century Fox. All Rights Reserved.
© 2024 Twentieth Century Fox. All Rights Reserved.
LAND / JAHR: USA, ITALIEN 2024
REGIE: ARKASHA STEVENSON
DREHBUCH: TIM SMITH, ARHASHA STEVENSON, KEITH THOMAS
CAST: NELL TIGER FREE, RALPH INESON, NICOLE SORACE, SÔNJA BRAGA, BILL NIGHY, MARIA CABALLERO, ANDREA ARCANGELI, ANTON ALEXANDER, TAWFEEK BARHOM, ISHTAR CURRIE-WILSON, MIA MCGOVERN ZAINI U. A.
LÄNGE: 1 STD 57 MIN
Wie macht man ein Prequel für einen Film, der fast schon fünf Jahrzehnte auf dem Buckel hat? Reicht da nur, diesem die Optik seines Nachfolgers zu verpassen? Mitnichten, denn Erzähltempo, Score und das Lebensgefühl der Siebzigerjahre sind da nur ein paar weitere Faktoren, die müssen schließlich auch berücksichtigt werden. George Lucas zum Beispiel musste in seiner Prequel- Trilogie zu Star Wars: Eine neue Hoffnung damit ringen, die zeitlich davor angesetzte Storyline nicht so aussehen zu lassen, als wäre sie ihrer eigenen Zukunft voraus. Nur teilweise ist ihm das gelungen. Bei Richard Donners Satansbraten-Thriller Das Omen, das sich mit einigen Sequels ebenfalls zu einem Franchise entwickelt hat, mag es einfacher sein, das ganze Ensemble in einen Siebziger-Look zu kleiden und ganz Rom mit Retro-Boliden auszustatten. Eingefangen wird das schmucke Szenario mit einem bereits aus der Mode gekommenen Kamera-Manierismus, der aus schnellen Zooms und etwas unkoordinierten Schwenks besteht. Unterlegt wird das Revival mit nostalgischem Score und über allem dann ein entsprechend ausgewaschenes Retro-Kolorit, welches sich bestens eignet für Nebel und Dunst und düstere Innenräume, die das Waisenhaus, in welchem die Protagonistin des Films, Novizin Margaret, anfangs landet und auch die engen Gassen der ewigen Stadt in eine mystische Atmosphäre taucht, wie sie vielleicht nur noch Nicolas Roeg mit seinem Gruselthriller Wenn die Gondeln Trauer tragen so formvollendet ins rechte schale Licht gerückt hat.
Wenn Margaret also mit mulmigem Bauchgefühl über verlassene Plätze und durch enge Gassen trippelt, wenn sie seltsame Räume aufstößt und sich in der Tür, die in den dunklen Keller führt, stilsicher als dem Unheil sehr nahe gekommener Schattenriss abzeichnet, hat Das erste Omen mit unmissverständlich kalt komponierten, ikonischen Bildern die Aufgabe gemeistert, als Prequel eines Films, dessen Erzählweise längst von schnelllebigen Rhythmen im Horrorgenre abgelöst wurde, bestens zu funktionieren. Das allerdings ist die eine Sache. Die andere ist die, so sehr dem Original nahegekommen zu sein, dass selbst der Horror eine gewisse Vorgestrigkeit aufweist, der man eigentlich nur mit dem Grundton des Films widersprechenden Schreckmomenten beizukommen versucht, die der unheilvollen und mühsam aufgebauten Mystery mehr den Wind aus den Segeln nimmt als ihm dabei zu helfen, sich vollends zu entfalten.
Die Geschichte selbst ist schnell erzählt, und auch hier entspricht sie Donners Klassiker, da sie keinerlei Anstalten macht, ihr Publikum großartig an der Nase herumzuführen. Es lässt sich ahnen, was passieren wird, doch Filme wie diese leben von einem satten Gefühl, gemeinsam dem Unerklärlichen entgegenzutreten. Eingangs erwähnte Margaret, selbst Waise und aufgewachsen in einem Kloster irgendwo in den USA, reist also auf Einladung ihres Ziehvaters und Kardinals Lawrence (Bill Nighy) nach Rom und bereitet sich darauf vor, bald ihr Gelübde abzulegen. Während ihrer Arbeit im Waisenhaus macht Margaret Bekanntschaft mit einem geheimnisvollen Mädchen, das genauso von Visionen geplagt wird wie sie selbst. Hinzu kommt, dass ein gewisser exkommunizierter Geistlicher namens Brennan – Kenner des Originals wissen: Er wird Gregory Peck über die Bedeutung Damiens aufklären – genau dieses Mädchen mit der Ankunft des Antichristen in Verbindung bringt. Und Margaret darauf ansetzt, diese zu vereiteln. Die junge Frau wird somit immer tiefer in geheimnisvolle Verstrickungen und unheilvolle Begebenheiten hineingezogen, alles wird bedrohlicher und gefährlicher und keine Nonne in diesem Waisenhaus ist das, was sie vorgibt zu sein.
Die katholische Schwesternschaft muss abermals stark sein: Schon wieder gibt es einen Horrorfilm, der die schwarzweiß gekleideten Dienerinnen Gottes mit diabolischem Grauen in Verbindung bringt. Da hätte es doch gereicht, dass die grässliche Jumpscare-Nonne Valak aus dem Conjuring-Universum deren Image nicht gerade aufpoliert. Nun aber hängt die ganze katholische Kirche mit drin, es ist wie in der Netflix-Serie Warrior Nun, in der Nonnen zumindest als martialische Kämpferinnen im vom Teufel infiltrierten Vatikan ordentlich aufräumen. Hier, in Das erste Omen, brennen und hängen, tuscheln und kichern die Damen im Habit auf Teufel komm raus, und immer wieder wünscht man sich Whoopi Goldberg als Schwester Mary Clarence her, die den Laden wohl ordentlich aufgemischt hätte und all die irren Ideen dem verkorksten Haufen mit hüftschwingender Musik ausgetrieben hätte. Doch nein, es bleibt düster, und es bleibt gediegen. In wenig erschreckender Langsamkeit, dafür aber mit reichlich Stimmung, investigiert sich die wirklich famos auftrumpfende Nell Tiger Free (Game of Thrones, Servant) in eine selbsterfüllende Prophezeiung hinein, die begleitet wird von stilfremden Grusel-Versatzstücken, die sich so anfühlen, als wären sie im falschen Film. Lässt man die mal außer Acht, und auch eine gewisse Anbiederung an Roman Polanskis weitaus mysteriöseren Horror Rosemary’s Baby, bleibt ein sakraler Thriller, der mit Lust einige Unklarheiten aus dem Original-Omen glattbügelt, dabei aber zu sehr darauf bedacht ist, nahtlos an den folgenden Plot, den der Klassiker mit sich bringt, anzuknüpfen. Das Fan-Service bleibt dabei nicht außen vor, und der Kompromiss aus Zugeständnissen und ungelenken Konstruktionen stimmt immerhin so weit, dass gar eine Fortsetzung möglich wäre – als Spin Off, dessen Handlungsbogen wohl eher als Serie gefällt. Der Stoff, der noch folgen könnte, wäre in der Wahl seiner Mittel dann weitaus freier.




 © 2023 Netflix Österreich
© 2023 Netflix Österreich © 2018 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
© 2018 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH © 2018 Luna Filmverleih
© 2018 Luna Filmverleih © 2018 Netflix Österreich
© 2018 Netflix Österreich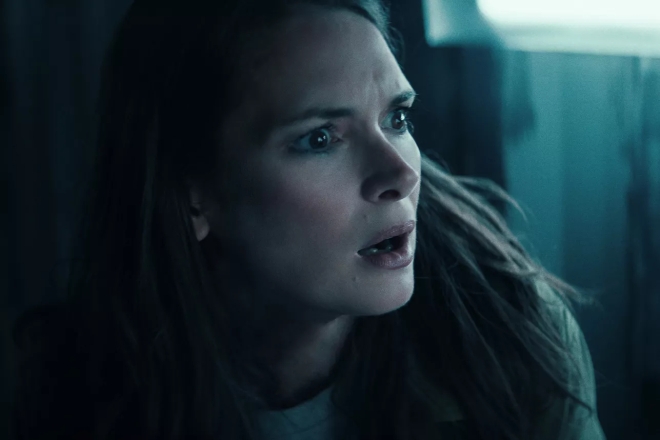 © 2022 Vertical Entertainment
© 2022 Vertical Entertainment