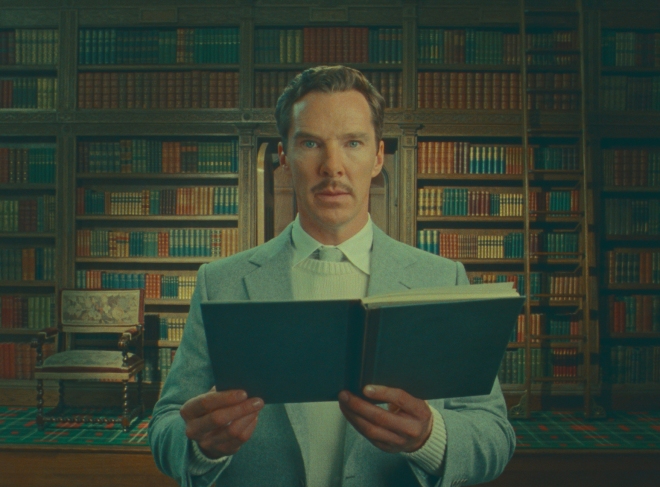DER TROST VON TIEREN
7/10
 © 2023 Limerencia Films
© 2023 Limerencia Films
LAND / JAHR: MEXIKO, DÄNEMARK, FRANKREICH 2023
REGIE / DREHBUCH: LILA AVILÉS
CAST: NAÍMA SENTÍES, MONTSERRAT MARAÑÓN, MARISOL GASÉ, SAORI GURZA, TERESITA SÁNCHEZ, MATEO GARCIA ELIZONDO, JUAN FRANCISCO MALDONADO, IAZUA LARIOS, ALBERTO AMADOR U. A.
LÄNGE: 1 STD 35 MIN
Geburt und Tod – die beiden Eckpfeiler unserer Existenz, die unverrückbar Anfang und Ende unseres Zeitstrahls markieren, dazwischen kann sich jede Menge abspielen, von Glückseligkeit über Erfolg, von der Niederlage bis hin zur Tragödie. Von Gesundheit über Krankheit zur Genesung. Diese beiden Eckpfeiler bringt die mexikanische Autorenfilmerin Lila Avilés zusammen. Es ist, als würde sie den Raum krümmen, um die beiden auseinanderklaffenden Ereignisse näher zusammenzubringen und sie zu verschmelzen zu einer Medaille mit naturgemäß zwei Seiten. Das bekommt man hin, wenn der Geburtstag eines todkranken Menschen ins Haus steht. Von einem, dessen Tod am Horizont bereits zu sehen ist, der aber anhand eines Festes daran erinnert werden soll, als jemand geboren worden zu sein, der niemandem egal war. Es ist Tona (Mateo García Elizondo), Künstler und Vater des siebenjährigen Mädchens Sol (Naíma Senties) – wie die Sonne. An diesem einen Tag, auf den Avilés Film seine Kamera richtet, wird so Einiges passieren, doch nichts davon ist für sich alleine dramatisch genug, um daraus eine eigene Geschichte zu erzählen.
Tótem beginnt, als Sol zu ihren Tanten gebracht wird. Die wohnen mitsamt dem alten Vater und eben dem kranken Tona in einer stattlichen Hazienda mit vielen Räumen, jeder davon birgt eigene Episoden der Vorbereitung auf ein großes Fest, an dem alle zusammenkommen sollen – Familie, Freunde, einfach alle, die den Lebensweg Tonas begleitet haben. Sol ist von Anfang an irgendwie fehl am Platz. Sie ist zwar Teil der Familie, hält aber Distanz zu allen anderen. Der, zudem sie will, nämlich zu ihrem Vater, bleibt unerreichbar. Starke Schmerzen erleidend, muss dieser sich auf seinen letzten Auftritt vorbereiten, mithilfe einer sich aufopfernden Pflegerin namens Cruz, die als einzige eine gewisse Nähe zu Sol aufbauen kann, die wiederum lieber mit den Tieren interagiert, die sich im Garten versteckt halten. Diese anderen Lebewesen, die haben für das Mädchen eine besondere Bedeutung. Vielleicht jene eines Tótems – eines Wesens, das in seiner Art und Weise einzelne Personen oder die ganze Sippe symbolisiert.
Viel mehr Handlung gibt es kaum in diesem innigen Portrait einer aus dem Häuschen befindlichen Familie, einer fast unzählbaren Gruppe an Kindern und Erwachsenen, die jede und jeder für sich sowohl in heller Aufregung vor dem kommenden Fest in ihrer Geschäftigkeit sich selbst überholen oder nicht wissen, wohin. Und dann das unterschwellige Gefühl des Abschieds. Was also soll gefeiert werden? Das Leben oder der Tod? Oder ist nicht beides ein und dasselbe? Freude und Trauer, Lachen und Weinen, Haare färben, Duschen, Kuchen backen. Dazwischen der Auftritt eines Mediums, welches das Haus von bösen Geistern befreien soll. Irgendwo am Rande Sol, die sich ein Fort aus Kissen baut. Die nur auf ihren Vater wartet, einen Goldfisch geschenkt bekommt und letztlich in die Flammen der Kerzen auf der Geburtstagstorte starrt – vielleicht, um die Sphäre des Diesseits mit ihren Blicken zu durchdringen.
Was Avilés in ihrem Ensemblefilm so übermäßig gut gelingt, ist, ein aus vielen kleinen, alltäglichen Miniaturen ein vollständiges Puzzle zu legen. Anfangs fällt es einem selbst schwer, sich in dieses quirlige Chaos an Planen, Vorbereiten und Durchführen irgendwie zurechtzufinden. Man fühlt sich wie Sol, man geistert durch eine hektische Betriebsamkeit, ohne Halt zu finden. Avilés Werk ist somit ein Film, durch den man sich treiben lassen muss – und beobachten. Die Puzzleteile werden mehr, bald lernt man all die Verwandten kennen, und anhand ihrer kleinen Szenen aus Charakterstudie, Verhaltensmuster und sozialer Interaktion entsteht tatsächlich sowas wie Vertrautheit, die sich immer mehr steigert, als wäre man schlussendlich selbst Teil dieser Familie, die einem so seltsam bekannt vorkommt. Es liegt an der Natürlichkeit in diesen Szenen, an diesem fast intuitiven, vielleicht gar improvisierten Spiel, das fast den Charakter eines Stegreifstücks hat, denn nichts davon wirkt einstudiert und scheint nur aus einer spontanen, einmaligen Empfindung heraus entstanden zu sein. Das macht Tótem so lebendig, niemals langweilig, geradezu saukomisch und in seinen stillen Momenten metaphysisch genug, um die Hoffnung auf mehr als nur dieses Leben wie die Kerzen auf der Torte am Brennen zu halten.