NOT ONLY A DIAMOND IS FOREVER
7/10
 © 2025 Universal Pictures Austria
© 2025 Universal Pictures Austria
LAND / JAHR: USA 2025
REGIE: CRAIG BREWER
DREHBUCH: CRAIG BREWER, NACH DER DOKUMENTATION VON GREG KOHS
KAMERA: AMY VINCENT
CAST: HUGH JACKMAN, KATE HUDSON, ELLA ANDERSON, KING PRINCESS, JIM BELUSHI, FISHER STEVENS, HUDSON HILBERT HENSLEY, MICHAEL IMPERIOLI, MUSTAFA SHAKIR U. A.
LÄNGE: 2 STD 12 MIN
Es gibt da diese Aha-Erlebnisse, die ich mit Neil Diamond assoziiere. Zum einen jenen, der sich in Frank Oz‘ herrlicher Komödie Was ist mit Bob? versteckt. Neurotiker Bill Murray erklärt dabei den Grund, warum seine Ehe in die Brüche ging: „Es gibt zwei Arten von Menschen auf der Welt: Die, die Neil Diamond mögen, und die, die ihn nicht mögen. Meine Ex-Frau liebt ihn.“ Zum anderen die dritte Episode der siebten Staffel von The Big Bang Theory, in welcher Simon Helberg und Mayim Bialik, die in ihren Filmfiguren nichts miteinander gemeinsam haben, ihre Liebe zu besagtem Sänger entdecken, indem sie, fahrend im Auto, im Duett Sweet Caroline schmettern. Jedes Mal, wenn ich diesen Klassiker höre, habe ich diese Szene vor Augen. Und, im Gegensatz zu Bill Murray, habe ich Neil Diamond insofern schätzen gelernt, da seine Lieder das Zeug haben, als Ohrwürmer tagelang hängenzubleiben. So passiert mit Song Sung Blue. Da reicht es, im Kinoprogramm Craig Brewers Film zu erspähen, und schon summt das Hirn die Melodie. Immer und immer wieder.
Wie man Ohrwürmer wieder los wird
Die beste Methode, diese Dauerschleife zu durchbrechen, ist, das Lied tatsächlich ans Ohr zu lassen. Zum Beispiel aus der Kehle von Hugh Jackman, der auf gewohnt sympathische Weise den Sänger Mike Sardina verkörpert. Noch nie von ihm gehört? Das ist nicht so verwunderlich, wenn man kein eingefleischter Neil Diamond-Fan ist. Um Personen wie diese aus dem Showbusiness ins Licht des Allgemeinwissens zu rücken, braucht es Filme wie diesen. Und schon weiß man und vergisst auch nicht so schnell: Jackman im Langhaar-Look und blauem Glitzersakko, das ist Lightning – jener Mann, der gemeinsam mit Ehefrau Claire die Neil Diamond Tribute-Band Lightning & Thunder gegründet hatte, die in den Achtzigern jenen, die sich keine Neil Diamond-Konzertkarten leisten konnten und dennoch die Experience eines authentischen Konzerts genießen wollten, so richtig einheizten. Wie es dazu kam und was aus diesen beiden wurde, die zusammen eine Patchwork-Familie bildeten, weil beide Kinder aus ersten Beziehungen hatten – nicht nur das erzählt Brewer, basierend auf einer Dokumentation von Greg Kohs aus dem Jahr 2008. Er erzählt auch von Menschen und ihren Träumen, und wie sie jäh daran gehindert werden, diese auszuleben, weil das Dasein an sich niemals damit zögert, das Lebensglück zu brechen.
Das Mehr an Schicksalsschlägen
Neben den altbekannten Ohrwürmern Neil Diamonds bekommt eine viel weniger bekannte Nummer ihre würdige Interpretation: Soolaimon – wohl das Lieblingslied des zu früh verstorbenen Mike Sardina. Hugh Jackman und Kate Hudson sind stimmlich und auch in Sachen Performance absolut in der Lage, diesen und andere Songs zu meistern, somit vergeht der Film zwar nicht wie im Fluge, unterbricht aber immer wieder die relativ konstante, erzählerisch nicht ganz so geschickt strukturierte True Story, die sich aber ziemlich genau so zugetragen hat – manches will man ja gar nicht glauben und würde es, wäre es fiktiv, gar als etwas dick aufgetragen empfinden. Doch Schicksalsschläge sind des öfteren ungerecht verteilt, und manche bekommen mehr davon ab als andere. Die, die mehr abbekommen, sind Lightning & Thunder. Das geht ans Herz, wenn Lightning ohne Thunder nicht mehr Musik machen kann, weil es alleine einfach nicht mehr dasselbe ist. Liebe steht in Song Sung Blue großgeschrieben, doch nicht auf die schwülstige Weise, sondern verwoben in ein tragikomisches Auf und Ab mit manchmal mehr Tragik als erwartet, vor allem in der zweiten Hälfte, in welcher der Film seine Tonalität mutig verändert.
Jackman und Hudson sind beide gut in Form, an die Frisur Jackmans kann man sich gewöhnen, muss man aber nicht – diese ist wohl den Fakten geschuldet und auch einem Neil Diamond der Siebziger. Alles in allem beschert dieses in gewohnt amerikanischem und gleichsam bewährtem Erzählstil gehaltene Melodram Kinostunden, die man gerne investiert, weil mit Musik meistens alles besser geht und auch Filme ihren ganz besonderen Kick bekommen. So auch dieser.


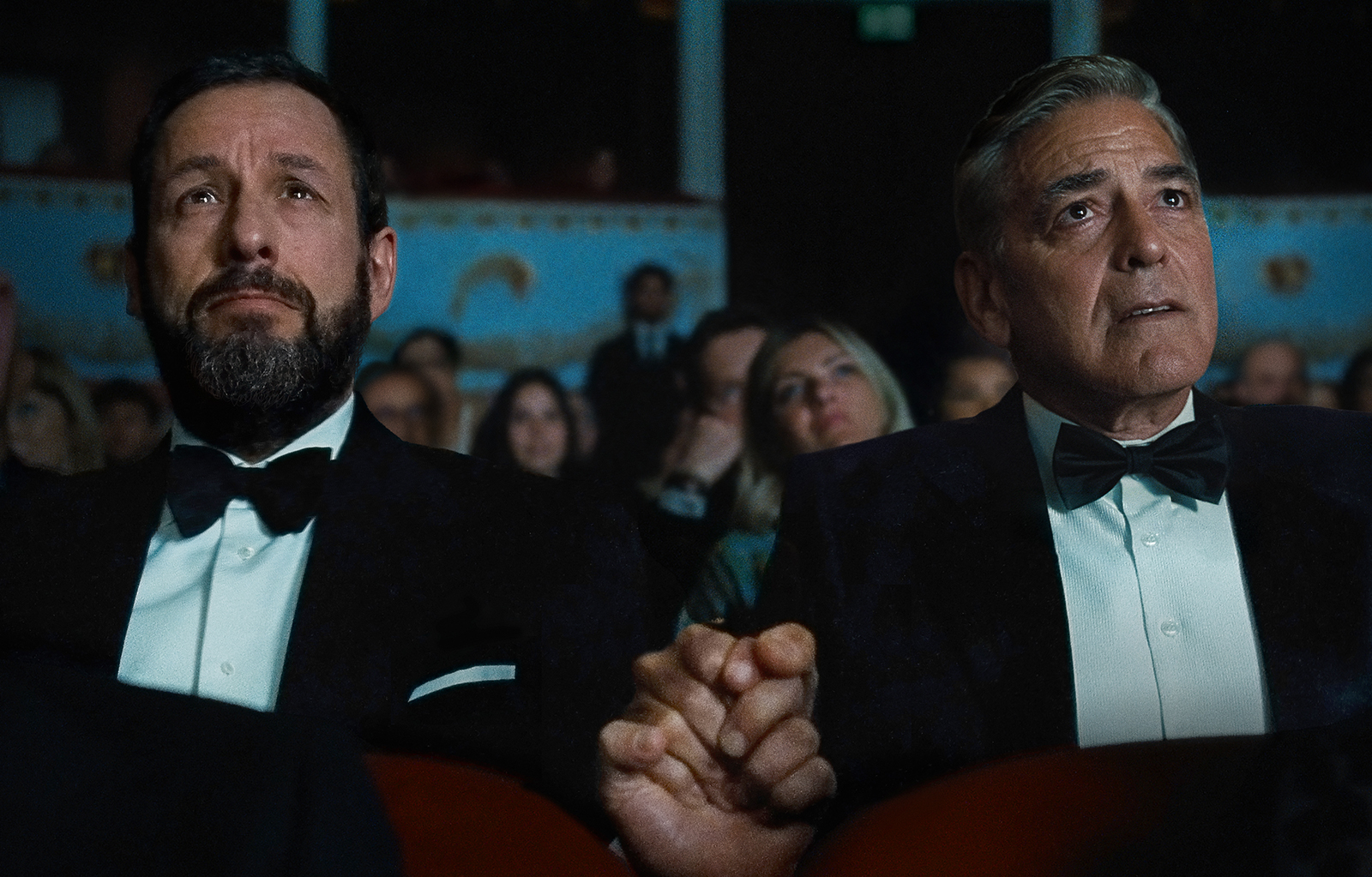



 © 2023 Copyright: LEONINE Studios / Wiedemann & Berg Film
© 2023 Copyright: LEONINE Studios / Wiedemann & Berg Film

