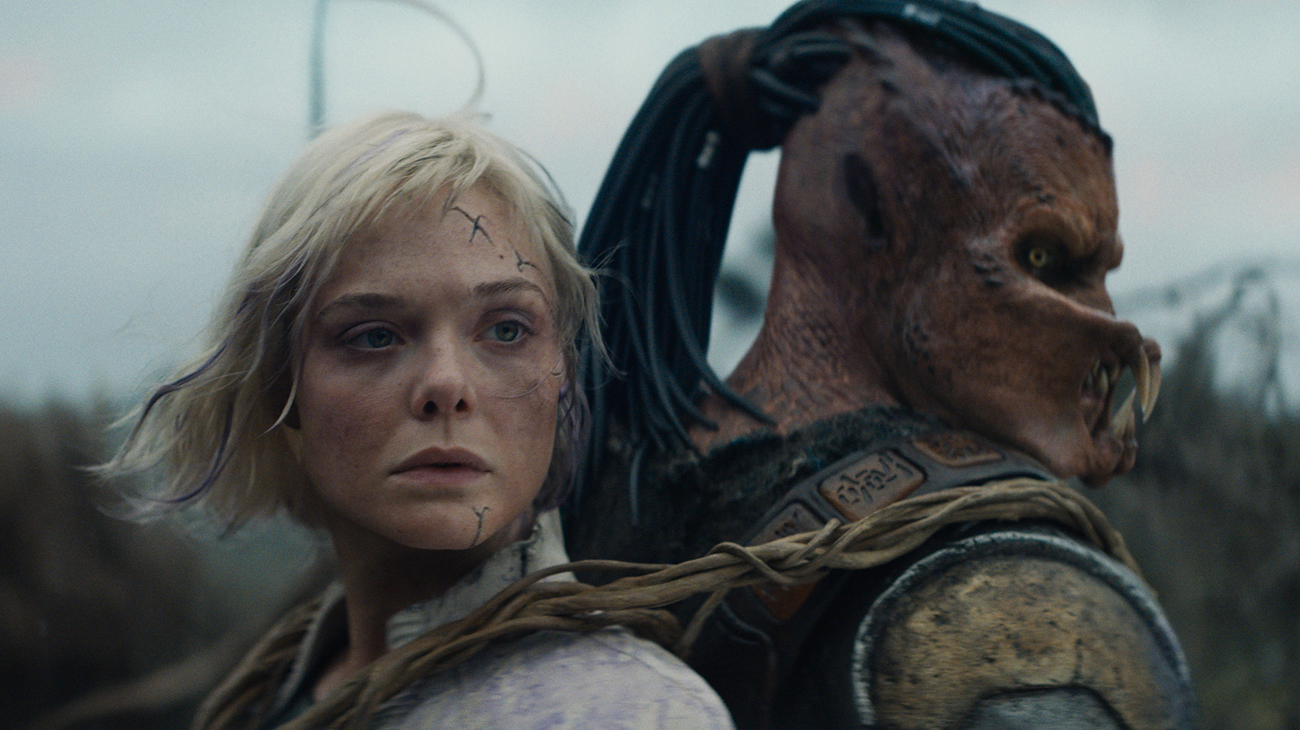LIEBLING, WIE SPÄT IST ES?
7/10
 © 2025 Filmladen Filmverleih
© 2025 Filmladen Filmverleih
ORIGINALTITEL: C’ÉTAIT MIEUX DEMAIN
LAND / JAHR: FRANKREICH, BELGIEN 2025
REGIE: VINCIANE MILLEREAU
DREHBUCH: JULIEN LAMBROSCHINI, VINCIANE MILLEREAU
KAMERA: PHILIPPE GUILBERT
CAST: ELSA ZYLBERSTEIN, DIDIER BOURDON, MATHILDE LE BORGNE, AURORE CLÉMENT, DIDIER FLAMAND, MAXIM FOSTER, ROMAIN COTTARD, BARBARA CHANUT U. A.
LÄNGE: 1 STD 43 MIN
Dieser Film ist ein Albtraum für alle, die in den Traditionen eine gewisse Notwendigkeit sehen, und in dieser Notwendigkeit beständige Werte, die man nicht überdenken darf. Die progressiven Nostalgiker von Vinciane Millereau (im französischen Original heisst es übersetzt: Morgen war es besser) zeigt eine werbewirksame, urban-europäische Welt aus den Fünfzigern mit Normen, die rechtskonservative Denker gerne zurückhaben wollen. Was das beinhaltet? Weniger Rechte für Frauen, vielleicht auch gar kein Wahlrecht, wer weiß? Selbige hinter dem Herd, während der Mann das Geld beschafft, arbeiten geht, fesch verschnürt mit Anzug und Krawatte. Daheim macht das Heimchen alles, was im Haushalt eben zu tun ist. Von Wäschewaschen über Putzen bis hin zu Kochen, und wenn der Göttergatte dann nachhause kommt, müde von der Büroarbeit, dann stehen die Pantoffel parat, das Essen auf dem Tisch, und bedient wird der Mann dann obendrein. So eine Familie sind die Dupuis, und Ehefrau Hélène fügt sich, weil sie auch nichts anderes kennt. Es fügt sich auch Ehemann Michel, doch worüber sollte er sich schon beschweren?
Waschmaschine statt DeLorean
Plötzlich ist Töchterchen Jeanne schwanger, ohne geheiratet zu haben. Dazu noch vom Nachbarsjungen! Was tun in so einer regressiven, verknöcherten Welt, die uneheliche Kinder nicht duldet? Natürlich, Zwangsheirat! Doch bevor es so weit kommt, spielen eine gewisse gewonnene Waschmaschine und der Stromkreis tragende Rollen. Mit dem nötigen Quäntchen Energie werden Hélène und Michel in eine andere Zeit katapultiert, und zwar mehr als sechzig Jahre in die Zukunft. Und alles ist dort anders. Wie verträgt sich so ein obsoletes Mindset mit den liberalen Errungenschaften einer Menschheit, die sich trotz aller Widerstände weiterentwickelt hat und die individuelle Freiheit feiert? Am meisten leidet Patriarch Michel, während er einen Weg bestreitet, der irgendwann die Nostalgie aus seinem kleinkartierten Weltbild vertreiben soll.
Den Männern bleibt aber auch gar nichts mehr
Als eine Art possierliches Zurück in die Zukunft könnte man diese clevere Boulevardkomödie bezeichnen, nur ohne eines abenteuerlichen Plots, der die eigene Existenz, in diesem Fall jene von Michael J. Fox, gefährdet hätte. In Robert Zemeckis‘ Komödie sind die Rollenbilder von damals weniger Thema, vielleicht auch, weil die Achtziger auch noch nicht reif dafür waren, um den Status Quo zu überdenken. Im Jahre 2025 sieht die Sache schon ganz anders aus, da fährt die Ungleichheit zwischen Mann und Frau wie ein Stellwagen ins Gesicht des Betrachters. Wenn Michel, knautschig-desperat dargeboten von Didier Bourdon, seine unverdienten Privilegien verliert, kann man fast schon Mitleid haben.
Am charmantesten ist die Komödie, wenn das Fünfzigerjahre-Ehepaar mit der neuen Welt konfrontiert wird; wenn sie beide ein Codewort zurechtlegen müssen, das „Wie spät ist es“ lautet, und jedes Mal gesagt wird, wenn beide das Wunder des wandelbaren Fortschritts nicht mehr einfach so hinnehmen können. Vinciane Millereau, die auch am Drehbuch mitschrieb, konzentriert sich bei ihrer Arbeit auf allerlei Details, die zur Sprache gebracht werden müssen. Es sind weniger die technologischen Errungenschaften wie elektrische Zahnbürsten, Eiswürfelautomaten oder Computer, auf die es hier ankommt. Seine aufgelegte Situationskomik verlässt der Film dann, wenn es um den Feminismus geht – um gleichgeschlechtliche Liebe, um Karriere, um den Wechsel vom Bürohengst zum Hausmann. In Die progressiven Nostalgiker scheint es, als wäre man am Zenit, was die Gleichberechtigung betrifft, doch in Wahrheit sind da immer noch Meilen voraus.
Ohne das Dazwischen
Verzweifeln, so meint die Komödie, darf man dabei nicht, wenn man sieht, was da noch vor einem liegt. Denn setzt man das Damals und das Heute ohne das Dazwischen nebeneinander, wie der Film es tut, wird deutlich, welch weite Strecken die Gesellschaft seit damals schon zurückgelegt hat. Das zu erkennen macht Freude. Zu sehen, wie die Selbstverständlichkeit des Patriarchats zerbröselt, weil Perspektiven verändert werden müssen, ist wahrlich progressiv. Die Nostalgie hat dabei nichts mehr zu melden. Es sei denn, man bringt das Heute ins Damals.